Bolivien - über alle Berge
Reise in die Vergangenheit der Inkas




Vorbereitungen für den Aufbruch.
Nachdem neuer Proviant gekauft und das Team um vier junge arbeitslose Goldgräber aufgestockt ist, sind wir fertig zum Abmarsch. Um fünf Uhr morgens stehe ich mit Pedro auf, die Kinder lassen wir schlafen. Von der Nachbarhütte dringt lautes Lachen, eine singende, hohe Frauenstimme mischt sich ein: Pedro's Frau und seine Schwester machen uns das Frühstück. Es ist kalt, eigentlich ist es in Cocoyo immer kalt. Wortlos holen wir die fünf bereitstehenden Lamas, binden sie im Innenhof zusammen und bepacken eines nach dem anderen. Ihr Trägerjob gefällt ihnen gar nicht, sie spucken nach uns und wir spucken solange zurück, bis sie aufgeben und sich fügen. Die jungen Männer unseres neuen Teams finden sich nach und nach ein. Eine Menge neugieriger Zuschauer steht im ersten Tageslicht an der Grundstücksgrenze, sie gucken alle über die steinerne Einfriedung - es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass niemand diesen Zaun ohne Aufforderung übertreten darf. Unser Frühstück ist mein Abschied von Cocoyo, wo ich zwei unbeschwerte, glückliche Tage unter der Obhut von Pedro's Familie verbringen konnte. Etwa 100 Einwohner, etliche Goldminen, ein öffentliches Bach-Klo, keine Elektrizität, ein Fußballplatz, der Fluß Cocoyo, 3 Kaufläden und mir wohlgesonnene Menschen: Das war Cocoyo, dessen Annehmlichkeiten in dem Moment verschwunden sind, in dem wir flußabwärts die letzten Lehmhütten hinter uns gelassen haben.

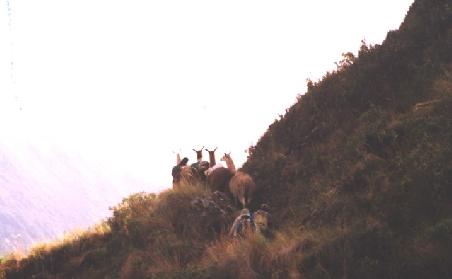

Rasch abwärts steigend geraten wir in dichtes Buschland, mit jedem Schritt hinunter wird es wärmer. Wir setzen uns zu einer kleinen Rast, die markanten Gesichter meiner bronzefarbenen, mandeläugigen Begleiter kenne ich schon, ich muß mir jedoch noch die Namen merken: Pedro Zonco, Juan Bautista, Paolino Guispe. Juan-Carlos Kea und Braulio Segundino. Jeder schiebt sich eine Bola Cocablätter zwischen die Backen, dann stehen wir auf und verfallen in jenen berüchtigten Indianertrab, der Kilometer um Kilometer frißt, dem ein Außenstehender jedoch nicht lange folgen kann. Aufsteigend gewinnen wir erneut Höhe, dann durchqueren wir in ständigem auf und ab endloses Grasland. Es beginnt zu regnen, das mannshohe Gras wird naß und wenn wir daran entlangstreifen fangen wir das Wasser mit unserer Kleidung auf. Wir treffen auf Spuren von Schwarzbären, die es hier, wo der Mensch nur noch selten hinkommt, in großer Zahl gibt. Vorsichtig sichern die Lamas jetzt nach allen Seiten, ansonsten folgen sie jedoch brav unseren Kommandos. Der Hang, den wir queren, endet tief unten im Regenwald. Wir stecken in dichtem Nebel und sehen gar nichts, können aber deutlich von den Tropen aufsteigende laue Lüfte spüren, die sich mit von oben kommenden kühlen Bergwinden mischen. Gegen Ende des Tages erreichen wir einen kleinen Bach, den wir für unser Lager auswählen. An der Wasserstelle ebnen wir im hohen Gras mit Schaufel und Pickel einen Platz für die Zelte, den wir etwas protzig "Marktplatz" nennen. Trotz der Höhe von etwa 3.900 m über dem Meer ist es hier bereits bedeutend wärmer, als im 400 m tiefer gelegenen Cocoyo, auf dessen Klima die kalten Anden großen Einfluß haben. Beim Abendessen prasselt ein heftiger Regenschauer auf uns herunter, der uns in die Zelte treibt. Wir legen uns früh schlafen, alles ist feucht. Der Regen dauert die ganze Nacht über an.


Unser neues Basislager im Grasland.

Morgens rufen sich irgendwo weit drunten Bären, ein Papagei ist zu hören. Alles ist feucht. Es hat aufgehört zu regnen, der Himmel ist zwar bedeckt, wir hoffen aber, daß es aufklart. Unsere Lamas grasen ganz dicht bei den Zelten, sie spüren, dass Raubtiere umgehen und fühlen sich nah beim Menschen sicherer. Wir brechen früh in Richtung einer Ruine auf, die vom Lager aus bereits zu sehen ist, sie heißt bei den Aymara Guinapi. Da niemand von uns den Weg kennt verlieren wir viel Zeit mit Suchen. Über Fels und steiles Grasgelände, fast schon Kletterei, muß vorsichtig abgestiegen werden. Wir gehen ohne Seilsicherung und passen auf wo wir hintreten, denn ein Absturz in diesem exponierten Gelände wäre tödlich. 2.000 m tiefer drunten brüllt ein Puma, seine Stimme klingt dumpf und eindringlich herauf.
Nach zwei Stunden erreichen wir die Ruine, die einst in etwa 4.000 m Höhe auf einem Doppelgipfel hoch über den Tropentälern erbaut wurde. Wir inspizieren die ganze Festung, um einen Überblick zu bekommen, haben wir doch vor, so viel altes Mauerwerk mit Schaufel und Pickel freizulegen wie wir können. Irgendwo müssen wir anfangen zu graben, bei der Größe der Anlage möchte man am liebsten kleinlaut zusammenpacken. Ich entschließe mich für eine handvoll Wohnhäuser, von denen wir uns systematisch zum Stadtkern, der äusseren Verteidigungsmauer, und dem Weg zum Haupttor vorarbeiten wollen. Unsere Pickel sausen auf Grassoden nieder, weggeräumter Dreck, Steine und Grasbüschel fliegen über die Böschung. Die Motivation der Truppe ist hervorragend, wir arbeiten wie die Besessenen und kommen schneller voran als ich dachte. Die Aussicht ist nach allen Seiten hin gewaltig, tiefe Tropentäler und verschneite Andenberge umgeben die Ruine wie ein aufgeklapptes Buch. Guimapi wurde an einem strategisch optimalen Punkt erbaut, der leicht zu verteidigen war. Die Festung ist rundum von leicht einzusehenden, steil abfallenden Hängen umgeben. Wir finden keine Quelle, aber Hinweise darauf, dass die Bewohner das Wasser der Regenzeit in Gräben aufgefangen und zu Zisternen geleitet haben. Noch nie hat mich eine Erstbegehung in den Anden so tief bewegt, wie der Fund der ersten Tonscherbe, die ich aus der Erde wühle. Unzählige Tassen, Teller, dickbauchige Flaschen aus Ton, auch fein gearbeiteter Tonschmuck kommen ans Tageslicht. Ein Hauch von Vergangenheit weht mich an. Nachmittags schließt sich die Wolkendecke, es beginnt zu regnen. Durch die Funde beflügelt hören wir nicht auf zu graben. Die Hände, die Kleidung, der Hut - alles, selbst die Unterhose starrt vor Dreck. Aber das ist uns egal, die gute Zusammenarbeit, schneller Geländegewinn und weitere sensationelle Funde lassen uns arbeiten wie Maschinen. Braulio entdeckt eine granitene Mörserschale mit Stößel, wenig später grabe ich eine tennisballgroße runde Kugel aus Granit aus. Sie diente als tödliche Steinschleudermunition für Scharfschützen. Um und um drehe ich die Kugel in meinen Händen, ich finde, daß sie viel zu schade ist, um sie jemand an den Schädel zu knallen. Nachmittags um fünf Uhr machen wir uns auf den Rückweg ins Basislager.

Die ganze Woche über haben wir schlechtes Wetter und graben weiter, täglich marschieren wir eine Stunde zur Ruine, eine Stunde brauchen wir zurück. Schließlich finden wir doch noch eine kleine Quelle unterhalb des Burghügels, dabei stoße ich in einer Höhle auf zwei eigenartige Kinderschädel mit etwa vier mal so hoher Stirn wie bei einem normal proportionierten Kopf und Hüftknochen, die von sehr großen Menschen stammen müssen. Der hohe Wuchs der Knochen läßt vermuten, daß es sich hier um eine ausgestorbene Rasse handelt, die nicht mit der kleinwüchsigen Aymara-Nation verwandt war. Was waren das für Menschen, von denen selbst die kleinste Spur einer Erinnerung fehlt? Bei unseren Grabarbeiten kommen Steinbänke, furchterregende steinerne Streitäxte, Steinschleuder-Kugeln aus Kupfer und gepflasterte Weganlagen zum Vorschein. Wenn man bedenkt, daß täglich je eine Person bei den Lamas zur Bewachung zurückgelassen werden mußte, und mit welch primitiven Mitteln wir uns abmühten, so kann ich mit Stolz behaupten: Wir haben viel geleistet und wurden mit hervorragenden Resultaten belohnt.




In der Ruine Guinapi.
In der Nacht hat es aufgeklart, die Temparatur ist stark gefallen und morgens ist der Regen auf dem Zelt gefroren. Die Seife ist alle und das Milchpulver geht zur Neige. Da wir nun wissen, wo es in Guinapi Wasser gibt, geben wir heute unser bisheriges Basislager auf und ziehen direkt in der Ruine ein, die uns bereits so vertraut ist, als hätten wir lange Zeit dort gelebt. Juan und Pedro packen unsere Funde zusammen, die sie in meinem Auftrag nach Sorata transportieren sollen. Nach einer umständlichen Einleitung rücken sie damit heraus, daß unsere Ausbeute, ihrer festen Überzeugung nach, mit einem bösen Zauber verhext ist, sie weigern sich deshalb, die Fundstücke in ihren Häusern aufzubewahren. Zum Beweis, daß die Ware völlig harmlos ist, zeige ich die Steinschleuderkugeln her, die mir als Kopfkissenunterlage dienen. Wie man sieht - ich lebe noch. Ich schlage eine Alternative vor: An verborgener Stelle außerhalb Cocoyo's, soll das nicht mehr benötigte Basislagerzelt heimlich aufgestellt und die Fundstücke dort deponiert werden. Damit wirklich niemand auf die Idee kommt, am Zelt herumzufummeln wird ein Schild angebracht: "Vorsicht, gefährlich, Zeltinhalt verzaubert!". Sollte das Zelt dennoch abhanden kommen, so übernehme ich dafür die alleinige Verantwortung. So schnell wie möglich wird der dubiose Inhalt nach Sorata geschafft und dort meinem Freund Louis Demers übergeben. Damit sind Pedro und Juan einverstanden, wenngleich ich von ihren Gesichtern ablese, daß ihnen nicht sonderlich wohl in ihrer Haut ist.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit machen meine abergläubischen Begleiter Anstalten, davonzulaufen, sie fürchten sich vor bösen Geistern, die sie im alten Gemäuer vermuten. Geduldig rede ich lange beschwichtigend auf sie ein, finde auf jedes wenn und aber die passende Antwort. Darüber wird es dunkel, ich habe gewonnen - denn jetzt fürchten sie sich vor dem durch die Ruinenanlage führenden Weg mehr, als davor, hier zu bleiben. Wie Schwule liegen wir ineinander verschränkt zu siebt im größten Zelt und erzählen uns Geschichten. Jemand beginnt von "Karisiris" zu reden, Personen, die zur Tarnung als Menschen unter uns sind, die auch in irgendjemand von uns stecken könnten. Nachts wird ein Karisiri zu einem Geist, der unvorsichtigen Männern, etwa Betrunkenen, die allein auf der Straße schlafen mit einer Art Spritze das Fett absaugen. Ein Opfer wird ganz langsam immer weniger, nach längerem Siechtum stirbt es. (Die Symptome deuten meiner Meinung nach auf eine Quecksilbervergiftung hin - Goldschürfer benützen dieses Teufelszeug.) Das Fett wird nach Amerika verkauft um die vielen Kriegswaffen zu schmieren. Eine Karisiri-Panik hätte mir gerade noch gefehlt. Ich wechsle schnell das Thema und gebe ein deutsches Wintermärchen zum Besten.
| Aufbruch: | 01.12.2003 |
| Dauer: | 5 Wochen |
| Heimkehr: | 01.01.2004 |
